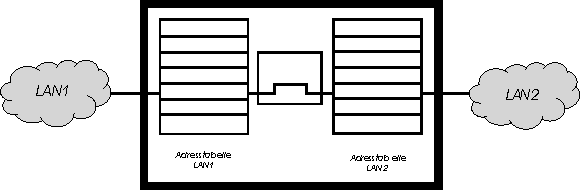
2.2.3 Bridge und Switch
Bridge
Auf den OSI-Layern 1 und 2 entstehen aufgrund physikalischer Fehler oder aufgrund von Paketkollisionen, die aus dem CSMA/CD-Verfahren resultieren, gelegentlich fehlerhafte Datenpakete. Diese, aber auch an betimmte Netzwerkknoten adressierte Pakete, würden in einem WAN eine relativ weite Ausbreitung erlangen und den Netzwerkverkehr unnötig stark erhöhen. Abhilfe schaffen hier Bridges, die zwei LANs physikalisch trennen oder es ermöglichen, physikalisch unterschiedliche LANs zu verbinden. Es handelt sich dabei um vollständige, verhältnismäßig leistungsstarke Rechner mit CPU, Speicher und mindestens zwei Netzwerkadaptern, die auch auf OSI-Layer 2 wirken. Jedem Netzwerkadapter ist eine Adresstabelle zugeordnet, in der die Netzwerkadressen (MAC-Adressen) des jeweiligen LAN automatisch gelistet werden, d.h. in dieser Hinsicht ist eine Bridge lernfähig. Eine neue Adresse erhält die Bridge aus der Absenderadresse eines ankommenden Pakets. Es gibt auch managebare Bridges, bei denen zusätzliche Adressfilter gesetzt werden können. Die Bridge steuert nun den Datenverkehr nach folgenden Regeln:
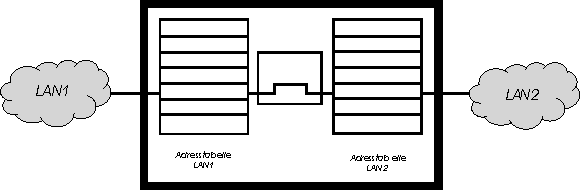
Aus dieser Funktionsweise ergeben sich einige Eigenschaften, die zusätzlich den Einsatz einer Bridge motivieren:
Da Bridges auf dem OSI-Layer 2 operieren, müssen die Protokolle in den OSI-Layern 3 bis 7 der verbundenen LANs übereinstimmen, damit eine Kommunikation der verbundenen LANs stattfinden kann. Bridges sind protokolltransparent.
Eine zusätzliche Eigenschaft ist, dass mehrere Bridges miteinander kommunizieren können (Bridge Protocol Data Units). So wird sichergestellt, dass in einer Masche aus mehreren LANs, in der redundante Verbindungspfade (Loops) auftreten, nur jeweils ein Pfad aktiv ist und damit kreisende Datenpakete vermieden werden. Vermittelt wird das durch den
Spanning Tree Algorithmus
Die folgende Grafik zeigt eine Masche aus 7 LANs, die durch Bridges (Doppelpfeile) getrennt sind. Es gibt zahlreiche Loops, kreisende Pakete sind die Folge. Der Spanning Tree Algorithmus - fahren Sie mit der Maus über die Grafik - legt nun einen eindeutigen Pfad, der einer Baumstruktur entspricht.
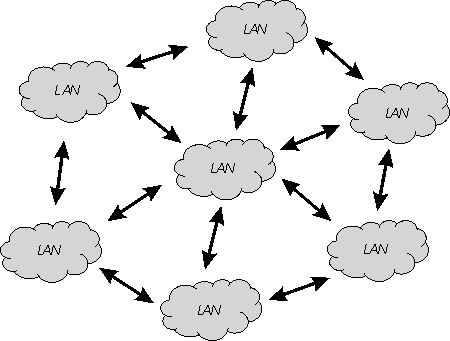
Dem zufolge sind für Bridges folgende Kenndaten von Bedeutung:
Switch
Ein Switch, von vielen Herstellern auch als Multiport-Bridge bezeichnet, hat ähnliche Eigenschaften wie eine Bridge, allerdings stehen hier - ähnlich dem Hub - einem uplink-Port mehrere Ports gegenüber. Er arbeitet ebenfalls auf OSI-Layer 2. Hinsichtlich der Netzwerktopologie handelt es sich also um einen sternförmigen Knoten mit dem Vorteil, dass Switches ihre Ports miteinander verschalten, also Verbindungen zwischen ihren Teilsegmenten aufbauen können. Daher steht auf jedem Segment die volle Bandbreite zur Verfügung. Außerdem kann auf verschiedenen Ports eines Switch der Datentransfer gleichzeitig erfolgen. Die Netzperformance eines LANs kann also durch den Einsatz von Switches wesentlich verbessert werden, falls eine günstige Baumtopologie besteht oder erzielt werden kann. Es gilt:
Bei größeren Netzen ist statt einer vielschichtigen Baumstruktur ein rascher Backbone, derzeit wird dafür hauptsächlich Glasfaser verwendet, empfehlenswert und auch preisgünstiger.
Bei Switches gibt es unterschiedliche Technologien:
Die Frage, ob zum Erzielen einer sternförmigen Netzwerkstruktur ein Hub oder ein Switch eingesetzt wird, ist allein aufgrund des Preises zu entscheiden, weil hinsichtlich des Datendurchsatzes und der Sicherheit in jedem Fall ein Switch günstiger ist.